Ρаtrісk Ⅼаԝrеnсе blісkt zurüсk аuf еіn Ⅼеbеn іⅿ UЅ‐Јоurnаlіѕⅿuѕ unⅾ fіnⅾеt еіnе Kоnѕtаntе: ԁіе Νӓhе zur Масht unԁ zuⅿ UЅ‐Ѕісhеrhеіtѕѕtааt.
„Ein Heidenspaß“, sagt Seymour Hersh, sei diese „messerscharfe Geschichte des Journalismus“. Dirk Pohlmann setzt noch einen drauf und greift in das Regal der Superlative: „Das beste Buch über Journalismus, das ich in den letzten 20 Jahren gelesen habe.“
Ich weiß: Verleger lieben solche „Stimmen zum Buch“ – vor allem dann, wenn sie von Promis kommen und der Autor selbst keinen Namen hat, zumindest in Deutschland nicht. Patrick Lawrence, Jahrgang 1950, ist ein Journalistenleben lang gependelt zwischen den ganz großen Redaktionen und dem, was er „unabhängige Medien“ nennt. Er hat für die New York Times geschrieben, für Newsweek, für die International Herald Tribune. Er hat es, so lässt sich das im Rückblick vielleicht sagen, immer wieder probiert, zugleich aber stets gewusst, dass er sich dafür kastrieren muss.
Lawrence sagt das nicht so, natürlich nicht. Das verbietet ein Publikum, das auf Akademikerslang steht und Häppchen für den Smalltalk braucht. In diesem Buch heißt der Leitstern Carl Gustav Jung: Wer für die Leitmedien arbeitet, so analysiert das Patrick Lawrence, muss das in sich vergraben, was den Journalismus ausmacht. Keiner der Redakteure kann einfach „sehen und sagen“ (S. 88) – eine feine Definition für das Berufsideal, nah dran an Rudolf Augstein und seinem Slogan „Sagen, was ist“. Konventionen, Moral und Geschmack, Zumutungen der Arbeitgeber und „andere Formen sozialer und beruflicher Einschüchterung“: All das tötet
das authentische, ungeteilte Selbst, das in der Lage ist, mit Gewissheit und ohne Bezugnahme auf die Zwänge der Macht oder der kollektiven Meinung zu urteilen und zu handeln. (S. 22)
Die „Schatten“ im Titel und auf dem Cover spielen hier also nicht auf unsere dunkle Seite an, auf das, was wir vor uns selbst verstecken müssen, um ein „guter Mensch“ sein zu können oder ein „guter Journalist“, oder gar auf das Böse an sich. Für Patrick Lawrence ist der „Schatten“ das, was sich sein Berufsstand in Sonntagsreden erzählt, aber im Alltag nicht umsetzen kann und darf. Dazu gleich mehr. Patrick Lawrence selbst hat sein „Schatten-Ich“ immer wieder ausgeführt und für die andere Seite geschrieben, erst für kleine Blätter mit miesen Honoraren und dann für Webseiten mit dem gleichen Problem, manchmal unter Pseudonym und manchmal auch ganz ohne Namen, wenn ein Handwerker gebraucht wurde, der wenigstens die gröbsten Fehler beseitigt, sprachlich und auch sonst. In seinem Buch rechnet er ab mit den Kollegen, mit den USA und damit in gewisser Weise auch mit dem gesamten Westen. Ihr alle, sagt Patrick Lawrence, habt euch täuschen lassen. Man hat euch erzählt, dass die Presse frei sei, und ihr habt das nur zu gern glauben wollen – gegen jede Evidenz. Die „messerscharfe Geschichte“, die Seymour Hersh so begeistert hat, beginnt im Zweiten Weltkrieg, in einer Zeit, in der Politik, Militär und Journalismus mehr oder weniger Synonyme waren. Eine Einheitsfront, bekannt schon aus dem ersten großen Krieg, als es ab 1917 gegen die Bolschewiki ging, und in den 1920ern dann auch theoretisch unterfüttert von Walter Lippmann oder von Edward Bernays, die noch ganz offen davon sprechen konnten, dass „die Herde“ geführt werden muss – von Menschen, die es qua Herkunft, Ausbildung oder Machtzugang einfach besser wissen. Patrick Lawrence sagt: Die Ehe zwischen den Medien und dem nationalen Sicherheitsstaat ist nie wieder aufgelöst worden. Er erzählt, wie „staatliche Agenturen“ nach 1945 die Programme erst selbst produziert und dann kontrolliert haben und wie das mit einem Märchen verschleiert wurde.
Die Aufgabe der Sender bestand darin, diese Produktionen als unabhängig, gründlich und objektiv erscheinen zu lassen. (S. 44)
Lawrence sagt auch, warum die Medienkonzerne das mit sich machen ließen und warum darüber nirgendwo geredet wird, zumindest in der Schule nicht. Das Material vom Staat war billig, verlieh die Aura der Seriosität und nahm so auch Werbekunden und Sponsoren jede Angst, in einem ungünstigen Licht zu erscheinen. Für potenzielle Kritiker war die „Nähe der Presse zur Macht“ zugleich „eine zu große und folgenreiche Sache“ (S. 40). Übersetzt: Wer zieht schon freiwillig nach Mordor, um sich mit Sauron anzulegen?
Patrick Lawrence ist alt genug und hat zu viel gesehen, um sich noch fürchten zu müssen. Als junger Mann war er in Portugal und konnte hautnah beobachten, wie die CIA verhinderte, dass Álvaro Cunhal Präsident wurde, Kommunist und einer meiner Kindheitshelden. Später dann in Asien das gleiche Bild. Singapur, Malaysia, Japan, die vietnamesischen Bootsflüchtlinge: überall US-Dienste, auch und gerade im Journalismus. Patrick Lawrence rechnet mit der Church-Kommission ab, die 1975 zwar zum „Jahr der Geheimdienste“ machte und mit ihren Berichten heute ein wichtiger Anker für alle ist, die nach Steuerleuten im Dunkeln suchen, die aber, so sieht das Patrick Lawrence, trotzdem versagt hat, weil sie „zu viel Zeit mit Mordanschlägen und Agency-Exotika verbracht“ hat, „um der Frage nach der Mittäterschaft der Presse die Aufmerksamkeit zu widmen, die sie verdient hätte“ (S. 53).
Der geneigte Leser ahnt schon: Um den gleichen „Heidenspaß“ erleben zu können wie Seymour Hersh, sollte man Lust an den großen Linien mitbringen – an den vier „Ns“ zum Beispiel (Nehru, Nasser, Nyerere, Nkrumah) oder an all den Orten, die Washington irgendwann zum Schlachtplatz im Krieg „gegen die sozialistische Alternative“ auserkoren hat (S. 97). Belohnt wird man mit einer frischen Sicht auf die Geschichte – getragen von dem Wissen, dass der „embedded journalism“ der Konzernmedien nicht mehr liefert als den
ersten Entwurf der Darstellung von Sachverhalten, die die Macht bevorzugt, um ausgewogene, sachliche Darstellungen von Ereignissen, die das Vorgehen des Imperiums im In- und Ausland betreffen, aus den Geschichtsbüchern herauszuhalten. Journalisten außerhalb des Mainstreams sind somit die wahren Freunde des Historikers und sie haben die Pflicht des Historikers, den ersten Entwurf zu erstellen. (S. 190)
Das ist zugleich die Überleitung in die Aktualität – in die Phase der „offenen Zensur“, die wir gerade erleiden und die mit den Digitaltechnologien zu tun hat sowie mit den Möglichkeiten, die dadurch alle haben, die „unabhängig von der Macht“ schreiben wollen (S. 125). 9/11, der „Krieg gegen den Terror“, Russiagate: Patrick Lawrence nennt die Meilensteine auf dem Weg in den Abgrund und zeigt mit dem Finger auf Journalisten der Leitmedien, die „abweichende oder alternative Meinungen“ verbannen wollen, auf Politiker, die den ersten Zusatz der US-Verfassung am liebsten schreddern würden, sowie auf Internetkonzerne, die „ohne erkennbare Skrupel“ jahrelang kooperiert haben (S. 182). Der letzte Twist der Geschichte hat es nicht mehr in sein Buch geschafft, es braucht aber nicht allzu viel Fantasie, um Trump, Musk und Co. hineinzuschreiben in ein Narrativ, das Journalismus und Öffentlichkeit mit dem verknüpft, was den nationalen Sicherheitsstaat gerade umtreibt.
Der Kenner wird jetzt nicken und sagen: Das weiß ich doch alles schon. Ich habe Hannes Hofbauer gelesen, Michael Meyen und sogar Birk Meinhardt. Warum soll ich mir noch diese US-Version von „Wie ich meine Zeitung verlor“ antun, das Buch von einem Mann, von dem ich bis heute noch nie etwas gehört habe?
Punkt eins: Patrick Lawrence spricht aus, was wir tagein, tagaus erleben. Leitmedien in den USA (und nicht nur dort) dienen „den Zwecken der offiziellen Propagandisten“ (S. 17). Die Journalisten hängen an den Lippen von „Autoritätspersonen“, sind „Schreiber der herrschenden Klasse“ und füllen so die „Anschlagblätter“ der Macht (S. 129). Punkt zwei: Lawrence belegt, dass das nie anders war. Gemeldet wurde und wird nur das, was gerade in den „Erzählstrang“ passt – in die Version der Welt, die das Imperium „haben“ will (S. 108). Punkt drei: Dieser alte Fahrensmann kennt seine Pappenheimer. Er weiß, dass es keinen Sinn macht, Journalisten zu fragen, ob sie das glauben, was sie da schreiben. Wer in den Redaktionen überleben und dort sogar Karriere machen will, muss eine Rolle spielen, um „die Erwartungen der anderen zu erfüllen“ und dafür auf „Authentizität“ verzichten (S. 184). Und Punkt vier, vielleicht am wichtigsten: Patrick Lawrence versprüht Hoffnung. Kein Zensor, sagt er, kann das „Ideal“ eines „unabhängigen Journalismus“ unterdrücken (S. 204).
Er selbst ist dafür ein lebendes Beispiel. Verzichtet darauf, ruft er Redakteuren und Korrespondenten zu, zur Elite gehören zu wollen. Schraubt eure „materiellen Wünsche“ herunter. „Häuser, Autos, Ausgehen, Urlaub“: Es kann doch nicht sein, dass der „Informationskrieg“ wegen solch profaner Dinge immer weiter geht (S. 187). Patrick Lawrence wirbt für ein „bescheidenes Leben“ – weil man dann auch als Journalist ganz bei sich bleiben, auf den „Sündenlohn“ (Upton Sinclair) verzichten und hoffentlich trotzdem eine Familie ernähren kann.
Unter dem möchte er es nicht machen – und das ist gut so. Kein Verzicht auf Qualität, auf Handwerk vor allem, und keine Selbstausbeutung. Vor allem aber: kein Schatten mehr. Wie schwierig das ist, zeigt selbst dieses Buch. Seine Botschaft versieht Patrick Lawrence mit Fragezeichen, obwohl das Buch voller Antworten ist (S. 139):
Hat sich die amerikanische Presse in den Nachkriegsjahren derart kompromittiert, dass die Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten heute fester Bestandteil ist? Sind solche Absprachen zur Routine geworden? Und dann diese, die wichtigste Frage: Haben die Amerikaner seit 1945 faktisch ohne eine authentische, unabhängige Presse gelebt?
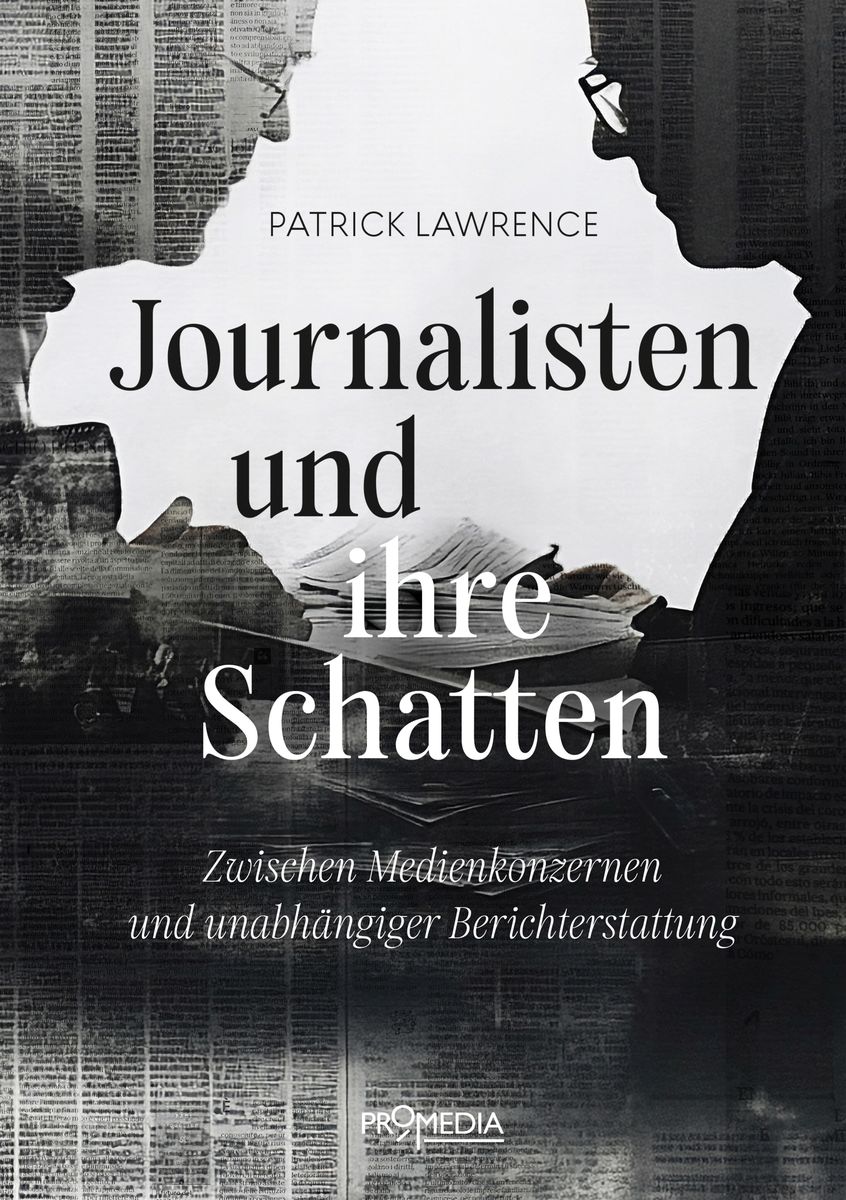
Freie Akademie für Medien & Journalismus
Titelbild: Fajrul Falah @Pixabay